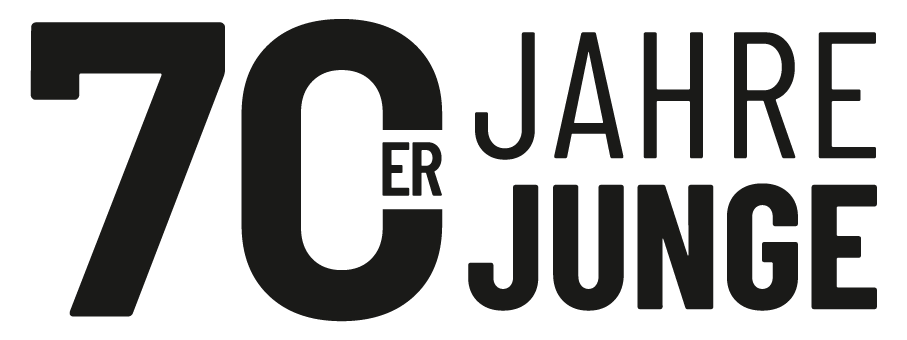Hausbootsause zwischen England und Wales
Durch England und Wales zieht sich ein Kanalnetzwerk, das vor 200 Jahren für den Gütertransport genutzt wurde. Heute werden die hier verkehrenden so genannten Narrowboats nicht mehr mit Pferdekraft, sondern per Diesel-Motor angetrieben. Ein Freizeitvergnügen, das den Spagat zwischen Entschleunigung und Aktivität schafft.
Birmingham // Whixall Marina – von der Bladerunner-Kulisse ins Boating-Idyll
Die Landschaft verändert sich von Minute zu Minute. Zunächst sind da noch die Suburbs von Birmingham mit ihren hutzeligen Häuschen, aus deren Dächern die für England typischen Schornsteine ragen wie von einem Pink Floyd-Cover. Bromwich, West Dudley … unser Fahrer, mit schätzungsweise indischen oder pakistanischen Wurzeln, brabbelt unentwegt in sein Telefon und steckt sich nach einem fragenden Blick, eine Kippe an. Wir haben gerade Shrewsbury passiert, Beton weicht zunehmend grünen Hecken, Wiesen, die ersten Kühe glotzen blöd in der Gegend rum.
Seinen Namen verrät unser Chauffeur nicht, doch er hat vier Kinder, und er hätte nichts dagegen hier auf dem Land zu leben, wo seiner Aussage nach mindestens jeder zweite Bauer heimlich Marihuana anbaut. „Have you seen any police yet?“ Stimmt, das sollte Beweis genug sein, das Gras-Anbau hier bombensicher ist.
No police – das war am nasskalten Abend zuvor noch anders, als wir nach unserer Zugfahrt vom Flughafen die New Street Station verlassen und unsere auf dem Asphalt ratternden Koffer Richtung Ibis Hotel ziehen. Eine halbe Garnison mit Warnwesten bekleideter Cops ist vor unserem Hotel stationiert, auch bei 12 Grad und Regen tragen die Mädchen hier konsequent bauchfrei, die Jungs sehen auch eher aus, als trügen sie mindestens eine Machete in ihren Baggy-Pants. Bladerunner-Kulisse statt Boots-Idyll.
Als wir schließlich Whixall Marina erreichen, unseren Heimathafen, ist der nasskalte Birmingham-Abend gefühlt Jahre entfernt. Eine sanfte Brise streicht über das Zelt des Waterside Cafés. Wir besorgen uns einen Kaffee. Country Club-Atmosphäre.
Schließlich begrüßt uns Marc. 1,70 groß, grünes Polohemd, Dreitagebart über im sonnenverbrannten Gesicht. Er hustet („too much smoking, harharhar“), deutet auf unser Narrowboat, die „Sunbury“, 14,63 Meter lang, ca. 2 m breit, unser Zuhause für die nächsten 14 Tage. Schlafzimmer, Duschkabine und Klo, Küche mit Gasherd und zwei Pritschen, die sich mit einem dünnen Brett zu einem zweiten Bett umfunktionieren lassen. Marc zeigt uns zwei verschiedene Knoten, die wir zum Anlegen dringend brauchen werden. Selbst den Maschinenraum müssen wir im Blick behalten und täglich prüfen, ob Öl ausläuft. Er hakt eine Liste ab. Erklärt. Erklärt. Check. Check.
Am Abend machen eine Erkundungstour zu Fuß. Am Kanal entlang, schlüpfen unter einem Backsteinbrückchen hindurch, Wiesen, Schafe. Wären uns Frodo und Gandalf entgegen geschlendert, gewundert hätten wir uns nicht. Am Abend bleiben wir im Hafen, füttern die herzallerliebste Entenfamilie, kochen auf unserem Gasherd irgendwas mit Nudeln (ohne Ente). Ein stilles Gluckern, ein sanftes Schaukeln, guter Schlaf.
Ellesmere – Schlangenlinienfahrt und eine Dusche mit Prostatabeschwerden
Der erste Morgen beginnt mit einer Dusche im geräumigen Sanitärbereich der Marina. Ein Luxus, den ich in den kommenden Tagen oft vermissen werde. Die Duschkabine auf dem Boot ist arg beengt, Wasser läuft spärlich, die Pumpe klingt, als habe sie mit Prostatabeschwerden im Endstadium zu kämpfen.
Der Schlüssel dreht sich Zündschloss, Dieselmotor hustet und knattert dann satt. Steuern ist – in der Theorie – einfach. Schub nach vorne = das Boot tuckert los. Viel Schub nach vorne = das Boot fährt ins Schilf. Schub nach hinten = das Boot fährt rückwärts ins Schilf (Steuern kaum noch möglich). Ruder nach links = Boot fährt nach rechts (und umgekehrt). Easy. In der Theorie. In der Praxis sind meine ersten 30 Minuten am Steuer die Fahrt eines Kapitäns mit sieben Promille. Der Kanal ist auf der Strecke zwischen Whixall und Ellesmere recht breit, Gott sei Dank. Die größte Gefahr sind ein paar tiefhängende Eichenzweige. Ich bin trotzdem jederzeit auf eine Frontalkollision im Autoscooter-Style vorbereitet.
Schließlich passiert uns ein Boot, das von einem braun gebrannten Sonnyboy gesteuert wird, neben ihm ein blondiertes Püppchen mit aufgespritzt Lippen. Wir winken, er zwinkert, sie winkt zurück und ruft begeistert: „Welcome from southern California!“ Surreal. Im späteren Verlauf der Reise wird das Winken zunehmend abgelöst vom wissenden Boater-Zunicken.
Kurz vor Ellesmere parkt schließlich Boot an Boot. „Sapphire“, „Robin“, „Blackwater“ – viele Einheimische besitzen ihr eigenes Narrowboat. Die Gestaltung ist individuell. My boat is my castle. Manch einer pflanzt einen gesamten Garten auf seinem Dach an, andere haben Hühner oder ihren Papagei dabei – fast jeder hat einen Hund an Bord.
Nicht mal eine schmale Parklücke ist hier zu finden. Mit unseren Navigationsfähigkeiten ohnehin undenkbar. Als wir schließlich auf die Abzweigung zusteuern, die eine Weiterfahrt ins Hafenbecken von Ellesmere oder wahlweise Richtung LLangollen (sprich: Länggofflen) offeriert, brüllt uns ein britischer Boater mit Freddy-Mercury-Schnauz aufgeregt an: „Turn the Tiller, full throttle!!!!“ Ja, ne, iss klar.
Ein paar 100 Meter weiter finden wir tatsächlich eine Anlegestelle. Dann folgt ein Manöver, das uns in den kommenden Tagen in Fleisch und Blut übergehen wird: Der jeweilige Kapitän steuert mit dem Bug das Ufer an, Maat 1 springt an Land, Maat 2 wirft Maat 1 ein Tau zu, das an der Mitte des Bootes befestigt ist. Maat 1 zieht das Boot an Land. Mit Eisenklammern, die an den Metallleisten befestigt werden können, die oft am Ufer angebracht sind, wird die „Sunbury“ befestigt.
Turn the Tiller, full throttle!!!
Abends geht’s zu Asian Spices, dem ortsansässigen Inder. Das Butter Chicken ist seltsam süßlich, aber lecker. Jedes Restaurant wird hier mit einem Hygiene-Rating ausgezeichnet. „Asian Spices“ hat 5, das bestmögliche Rating. Mein Kumpel versucht mich zu überzeugen, das 3 am besten sei. Ja, sicher. Zum Abschluss gibt’s einen Kaffee mit Likör. Ich frage, was denn Benedictine für ein Likör sei? Carl bringt die Flasche an den Tisch und verschwindet.
Wenn die Morgen nicht so kühl wären, könnte der Shropshire Union Canal fast ein wenig an den Amazonas erinnern. Träge steht die braune Brühe, Insekten gibt es zuhauf. „Catherina“ fährt vorbei, eine Bugwelle folgt, unser Boot knallt ordentlich ans Ufer. Lektion eins: je besser die „Sunbury“ befestigt ist, desto ruhiger das Frühstück. Das besteht zu einem ordentlichen Teil aus Eiern, kiloweise Cheddar-Käse, einem seltsamen Müsli, das die Konsistenz von kleinen Kieselsteinen hat und Shortbread. Wir bleiben zwei Nächte vor Ellesmere und entschließen uns, ein Abstecher in den Montgomery Canal zu unternehmen. Der Kanal führt durch ein Naturschutzgebiet, nur 12 Boote dürfen hier täglich reinfahren.
Ich hab inzwischen „Kaffee und Zigaretten“ von Ferdinand von Schirach durchgelesen. Ziemlich passend: ich konsumiere literweise Kaffee, meine beiden Begleiter sind für die Kippen zuständig (noch sind genügend da, später werden sie mit 14 Pfund zur Kasse gebeten. Autsch).
Montgomery Canal – Wir „mähen“ mit den Schafen – und die Bremsenattacke
Von Ellesmere bis zum Eingang des „Monty“, wie wir ihn ab sofort liebevoll nennen werden, ist es nur eine kurze Fahrt. Der freundliche Schleusenwächter mit Pudelmütze erwartet uns. Wir bekommen eine Kurzeinführung für die Bedienung der Schleusen. Mittels einer Metallkurbel wird die Schleuse geöffnet und die Kammer geflutet (oder geleert). Der Steuermann muss darauf achten, dass sich das Heck des Bootes beim Ablassen des Wassers nicht über dem „Cill“ befindet. Ein Fauxpas, der das Boot in Schieflage bringt. Das Worst-Case-Szenario. Unser Schleusenwärter hat‘s in seiner Zeit als Angestellter des Canal & River Trust dreimal miterlebt. Wichtigster Warnhinweis im Boater-Handbuch: Bloß nicht hinterher springen, wenn ein Besatzungsmitglied ins Wasser fällt.
Nach ein paar Minuten erreichen wir einen kleinen Minihafen, in dem wir Wasser nachfüllen können. 100 Gallonen passen in den Tank. Kaffee kochen, duschen, spülen. Komplett geleert kriegen wir den Tank während unserer kompletten Reise nicht.
Der „Monty“ ist eine andere Hausnummer als der Shropshire Union Canal. Die Spur ist eng, beide Ufer sind jetzt mit Schilf bewachsen. Die Bleche zum Befestigen des Bootes sind verschwunden. Wer hier festmachen will, muss Pflöcke in die Erde schlagen wie beim Zelten. Nach einer halben Stunde fahren wir uns zum ersten Mal fest. Wir versuchen uns mit dem hölzernen Pfahl, der zur Standardausstattung des Boots gehört, vom Ufer abzustoßen. Hilft nicht. Wir geben Gas, ein knirschendes Geräusch, aufgewirbelte Erdreich, Adrenalin, ein scheuer Blick ins Handbuch, wo stand gleich die Notfallnummer?
Vollgas im Rückwärtsgang hilft uns schließlich, das Boot wieder flott zu machen. So ist das Boater-Leben. Auf der einen Seite total entspannend, auf der anderen Seite darf man beim Steuern nicht 3 Sekunden abgelenkt sein.
Wir machen schließlich Halt neben einer Schafsweide. Wir „mähen“ ein wenig mit den Schafen um die Wette – und verlieren. Enid-Blyton-Idyll. Die abendliche Kniffel-Runde ist inzwischen Ritual. Der Verlierer muss spülen. Ich hab eine Pechsträhne. Die Insektendichte im Boot hat zugenommen. Das Viehzeug tanzt um die Lampen – und ist am Morgen seltsamerweise wie von Zauberhand verschwunden (ich hoffe nicht in meinem Mund). Ich bin gerade wach geworden und glotze an die Decke. Die Reflektionen des Wassers spiegeln sich am cremefarbenen Plastik des Boots. Total entspannend. Mir fällt auf, dass wir eine Art Nummernschild haben, „527902“, und frage mich, ob es möglich ist, ein Knöllchen zu bekommen? Für falsch anlegen? Ohne Licht in den Tunnel fahren? Zu viel Gas in die Kurve?
Eigentlich wollte ich die Zeit nutzen, um neue Texte zu schreiben. Da sitz ich nun also und notiere in mein Notizbuch:
Wir cruisen seit Tagen
und Ihr geht zu Fuß
Uns geht es vorzüglich
Ihr habt den Llangollen-Bluuuuuuueeees!
Naja, die Kreativität lässt sich bitten.
Wir fahren bis zum Ende des Montgomery Canals, wo ich mit viel Glück einen sauberen U-Turn hinlege und nicht eine weitere Kerbe in der Kaimauer hinterlasse. Stolz.
Nach drei weiteren Stunden Fahrt legen wir an, um Wasser nachzutanken und zu duschen. Ein älterer Herr steigt aus einem silbergrau lackierten Narrowboat, das mit seinen Bullaugen aus der Ferne aussieht wie ein Atom-U-Boot. Charles, 69, weißes Haar und Plauze, lebt seit 22 Jahren auf dem Boot. Er hat seine Freundin dabei und Twigger, einen freundlichen schwarzen Cocker-Spaniel-Mix mit Schlappohren und riesigen Löwenpfoten. Wir werden das Trio auf unserer weiteren Reise noch vielfach begegnen und uns sogar ein wenig anfreunden.
Charles klärt uns auf: Die Duschen hier seien Mist und einen sogenannten Pump-out, also das Entleeren des Toilettentanks, funktioniert nur mit einer speziellen Karte, die man allerdings nirgendwo mehr kaufen könne. Aha.
Ein Bremsengeschwader attackiert, ich schlage hysterisch um mich. Eine der dreisten braunen Biester beißt mich trotzdem in die Hand, die darauf deutlich anschwillt. Fucking Horseflies!!!
Abends gehen wir ins Queens Head essen. Eine Art Ausflugslokal, in dem sicherlich öfter mal Rentnergrüppchen in Reisebusse angekarrt und abgeladen werden. Gefühlt jedenfalls. Ich bestell ein (wie sich später herausstellen wird recht mittelmäßiges) Steak und ein Guiness. Auf dem Rückweg zum Boot regnet es. Kleine Frösche hüpfen überall auf dem matschigen Fußweg hin und her.
Am nächsten Morgen verpassen wir unseren Timeslot und sind zu spät an der Schleuse, sodass wir einen weiteren Tag im „Monty“ verbringen. Wir legen im Minihafen an. Unser Bootsnachbar, Barry, ein Liverpool-Fan, gibt uns Restauranttipps für unsere weiteren Stationen in Chirk und LLangollen. Er mag uns Deutsche und versichert mir: „Jürgen Klopp is the Messiah!“
Freundschaft schließen wir auch mit einer Engländerin mit schlechten Zähnen, die in einem etwas heruntergekommenen gelben Boot mit zwei Hunden residiert. Sie gibt uns einen Tipp, wie wir den Wasserschlauch mit einem gekannten Wurf über den Kanal buchsieren.
Auch ein kleines außerordentlich sauberes Klohäuschen steht hier für die Boater bereit, sogar mit Entertainment (Bücher und Hörspielkassetten). Die Zeit ist hier deutlich stehen geblieben.
Chirk – Der verfluchte Wald neben der Holzfabrik
Schließlich verlassen wir den „Montgomery Kanal“ und Steuern auf Chirk zu. Das Lenken des Bootes klappt inzwischen deutlich besser. Auch durch die schmalen Stellen unter den Brücken hindurch navigieren wir die „Sunbury“ inzwischen ohne anzustoßen.
Kurz vor Chirk erreichen wir die aus touristischer Sicht ersten Highlights der Reise. Wir schippern über eine schmale Wasserstraße entlang des monströsen Chirk Aqueduct. An einigen Stellen ist der Kanal jetzt so eng, dass nur ein Boot Platz hat. Jetzt ist Kommunikation gefragt. Die Verhandlungen, welches Boot zuerst fahren darf, ist meist freundschaftlich. Auch als es in den 421 Meter langen Chirk Tunnel geht. Eine große Tafel weist auf Fledermäuse im Tunnel hin. Wir schalten das Frontlicht ein, hupen dreimal beherzt in die Dunkelheit und fahren ins Ungewisse.
Früher, so sagt man uns, hätten die Boater sich im Tunnel fortbewegt, indem sie sich mit den Füßen an der Decke abgestoßen hätten. Jetzt bin ich doch froh, dass wir unseren Diesel-Motor haben. Auch die Grenze von England nach Wales haben wir inzwischen passiert, als wir in einem kleinen Waldstück nahe Chirk anlegen. Ein düsterer Ort, wie sich im Nachhinein herausstellen wird.
Ein Schrei hallt durch den Wald
Auf dem Weg zum Restaurant gellt ein Schrei durch den Wald. Wir rennen los.
Eine Frau mit kurzen roten Haaren steht fassungslos im Wasser, Blut rinnt ihr über den Hinterkopf. Ihr Rottweiler, der ziemlich traurig und orientierungslos aussieht, hat sie ins Wasser gezogen. Wir ziehen sie an den Armen heraus. Auch ihr Mann, der das Boot inzwischen angelegt hat, kommt auf uns zugerannt. Die beiden bedanken sich tausendfach.
Wir schaffen es schließlich ins Castle Bistro, einem Restaurant, das uns der Liverpool-Fan empfohlen hat. Ich bestelle eine Persian Tandoori-Pizza. Das Essen ist großartig. Auf dem Rückweg decken wir uns beim Spar mit weiterem Shortbread ein. Ich bilde mir ein, dass die Menschen jetzt mehr wie Waliser aussehen und weniger wie Engländer. Irgendwie rothaariger. Das ist wahrscheinlich Schwachsinn.
Die Nacht ist unruhig, gleich neben unserer Anlegestelle weht das Quietschen und Zischen von der nahegelegenen Holzfabrik herüber. Am nächsten Morgen erzählt einer meiner Begleiter von einem gruseligen Albtraum. Auch ich werde noch Tage später düster von der Anlegestelle träumen. Mich würde nicht wundern, würde hier ein verfluchter Holzfäller spuken.
Llangollen – Gemütliche Tage im elbischen Ausflugsparadies
Ich bin froh, als der Morgen anbricht. Endlich geht es Richtung Llangollen, einem Höhepunkt der Reise. Unser Badezimmer hat inzwischen einen unerfreulichen Geruch angenommen. Ich rufe bei der Marina in Trevor an und buche einen Pump-out-Termin.
Die weitere Fahrt ist recht ereignislos, bis wir das Pontcysillte Acqueduct erreichen. Ein unfassbares Bauwerk, bzw. „Bodentragwerk“, wie es im Fachjargon heißt, das uns über das Tal des Flusses Dee führt. Das Aquädukt wurde 1805 fertiggestellt und ist das längste und höchste Aquädukt in Großbritannien. Es steht seit Juni 2009 auf der Liste des UNESCO- Weltkulturerbes.
Die Landschaft nimmt hier noch einmal an Vielfalt zu, teilweise fühlt man sich wie in einer Heidi-Kulisse mit zu wenig Bergen. Auch eine deutliche Strömung setzt hier ein, was das Navigieren des Bootes schwieriger macht. Kurz vor Llangollen müssen wir eine weitere Engstelle passieren, was uns fast 1 Stunde Zeit kostet.
 Wir mieten für 6 Pfund pro Tag einen Anlegeplatz im Hafen von Llangollen, wo die Boote dicht an dicht stehen, wie die vergessenen Schuhe eines Riesen. Ich Steuer auf unsere Anlegestelle zu und kommen neben der deutlich imposanteren „Triskaideka“ zum Stehen. Es ist schön, wieder in der Zivilisation zu sein. An den Straßenschildern wird jetzt auch deutlich, dass wir in Wales sind. Und schon wieder eine Herr der Ringe-Referenz. YSBWRIEL bedeutet Müll und erinnert zumindest mich stark an Elbisch.
Wir mieten für 6 Pfund pro Tag einen Anlegeplatz im Hafen von Llangollen, wo die Boote dicht an dicht stehen, wie die vergessenen Schuhe eines Riesen. Ich Steuer auf unsere Anlegestelle zu und kommen neben der deutlich imposanteren „Triskaideka“ zum Stehen. Es ist schön, wieder in der Zivilisation zu sein. An den Straßenschildern wird jetzt auch deutlich, dass wir in Wales sind. Und schon wieder eine Herr der Ringe-Referenz. YSBWRIEL bedeutet Müll und erinnert zumindest mich stark an Elbisch.
Neben uns hat inzwischen ein Mit-Boater angelegt, der aussieht wie eine Mischung aus Clay Morrow und Versicherungsmakler. Wir haben ihn vor dem Chirk-Tunnel kennengelernt. Er winkt freundlich herüber. Überhaupt haben wir bisher nur freundliche Begegnungen gehabt.
Die Tage in Llangollen sind gechillt. Wir essen im M’Eating Point, einem netten Restaurant (Hygiene-Rating 4), in dem 90er-Musik gespielt wird. Neben uns sitzt eine Familie, Eltern, Tochter, Sohn – jeder einzelne des Quartetts glotzt auf sein jeweiliges Handydisplay. Ein befremdliches Szenario. Das Essen – Tomate Mozzarella, Crispy Lamb mit Joghurt-Minz-Soße – ist lecker. Allerdings klebt in der Kaffeetasse ein grüner Knödel fest, eine vergessene Pistazie vielleicht. Ich will‘s gar nicht wissen, Hygiene-Rating 4 halt.
Am nächsten Tag wandern wir zu den Horseshoe Falls. Eine Tafel klärt über die Historie des Llangollen Canals auf. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die Boote hier noch mit Pferdekraft über das Wasser gezogen – bis zum Siegeszug der Eisenbahn. Die Eisenbahn-Gesellschaft habe die Kanäle schließlich aufgekauft und stillgelegt, erzählt uns jemand. Fortschritt. Erst in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde der Kanal insbesondere für den Tourismus wiedereröffnet. Im The Chainbridge Hotel bestellen wir bei einem gesichtstätowierten Kellner ein Sandwich und genießen den Ausblick auf die Schlucht, über die eine Brücke führt (The Chainbridge?), die ein wenig aussieht wie eine nicht fertig gebaute Goldengate Bridge in weiß. Der Abend endet im Pub.
Am nächsten Tag bringen wir unsere Klamotten in die Wäscherei (aahh, frisches Handtuch!), essen beim Inder (The Royal Spice, 4 Sterne, Klogeruch, nicht zu empfehlen). Auch Charles hat inzwischen im Hafen von Llangollen angelegt. Er empfiehlt uns, rechtzeitig von hier zu verschwinden, weil in wenigen Tagen das Llangollen International Musical Eisteddfod Festival starten soll. Bald, sagt er, würden zahlreiche Boote Richtung Llangollen steuern. Vor den Schleusen würden sich lange Schlangen bilden, prophezeit er.
Dann erzählt er uns die Geschichte eines Touristen, dem das Bootsleben so gut gefallen habe, dass er sein Mietboot umlackiert habe, um damit durchzubrennen. Wir lachen.
Unsere Rückfahrt – Die Pump-out-Geschichten des Surfer-Piraten von Trevor
Die Rückfahrt verläuft smooth, nur an einer Schleuse müssen wir uns einreihen und anderthalb Stunden warten. Wir vertreiben uns die Zeit mit Seilchenhüpfen mit dem Anlegetau. Bei Trevor steuern wir noch einmal den Pump-Out an. Der Mitarbeiter unseres Bootsverleihs Anglo Welsh, der eine lange blonde Raster-Mähne trägt – und dementsprechend aussieht wie ein Surfer-Pirat – erzählt diabolisch grinsend, wie eine Bootstourist am vorangegangenen Tag Wasser habe „stehlen“ wollen, dafür aber versehentlich den Schlauch genutzt habe, der für das Reinigen des Pump-out-Schlauchs vorgesehen ist. Unser Rasta-Pirat habe sich den Diebstahl in aller Ruhe lächelnd angesehen ohne einzugreifen. Hmm, lecker.
Wir passieren an diesem Tag den Grusel-Wald von Chirk, legen hinter dem Tunnel an, marschieren aber wieder ins Castle Bistro. Wir müssen entlang einer Landstraße. An den Linksverkehr habe ich mich noch immer nicht gewöhnt. Diesmal gibt’s Chorizo Risotto. Satt und müde gehts zurück zum Boot, das wir für diese Nacht mit Pflöcken befestigen müssen. Am Morgen werde ich vom Scheppern des Bootes geweckt, das immer wieder gegen das Ufer gedrückt wird. Ätzend.
Ich hab inzwischen die Biografie von Dave Grohl durchgelesen, die ich mir im Tesco von Ellesmere gekauft hab. Voller Tatendrang schreib ich noch vier Seiten mit Songtexte voll. Leider alles Schrott, wie sich nach der Durchsicht herausstellt.
Das Steuern der „Sunbury“ ist inzwischen Routine. Inzwischen sind nur noch kleine Korrekturen des Ruders notwendig, um das Boot in die richtige Richtung driften zu lassen. Yeah! Cruisin‘ like a Pro. Selbst das Einparken in eine ziemlich enge Lücke in Ellesmere klappt halbwegs. Wir machen noch einmal los und finden einen Top-Platz im Hafenbecken. Das Ende unserer Reise rückt näher. Ich bin hin- und hergerissen. Auf der einen Seite freue ich mich auf mein eigenes Bett und meine Dusche. Auf der anderen Seite bin ich jetzt schon sicher, dass ich die „Sunbury“ genauso vermissen werden, wie unsere gemeinsamen Frühstücke, Abendessen und Kniffel-Schlachten.
Noch einmal zieht es uns zum indischen Restaurant, diesmal entscheide ich mich für ein köstliches Pilzgericht namens Mushroom Piazza (oder so ähnlich). Dazu den obligatorischen Likör-Kaffee.
Am Morgen werde ich vom ballernden Diesel-Motor eines Narrowboots geweckt, das das Hafenbecken verlässt. Ich blicke aus dem Fenster und sehe ein letztes Mal Charles, der mit gelber Warnweste und napoleonischem Stolz sein U-Boot durch den Kanal steuert. Ich klopfe ans Fenster, doch er sieht mich nicht. Stattdessen schwimmt draußen nur eine Armlänge entfernt eine Schwanfamilie vorbei. Mama und Papa in Weiß, der Nachwuchs noch etwas zerzaust und grau. Alle hungrig.
Am nächsten Tag laufen wir durch die Stadt, über einen alten Friedhof und gelangen schließlich ans Ellesmere, einen klaren See mit anliegenden Ausflugslokalen. Auch hier stürzt sich das gefräßige Geflügel auf uns. Enten, Gänsen, Schwäne. Hier könnte Hitchcock definitiv die Inspiration für „Die Vögel“ herhaben.
Ich verliere wieder beim Kniffel, immerhin nicht die Runde, bei der es ums finale Badputzen geht. Der letzte Abend endet im Black Lion Pub bei einem Steak und den obligatorischen, viel zu dick geschnitzten Pommes (Pommes gibt‘s hier übrigens zu jedem Gericht, selbst zu Lasagne oder Pizza). Wir sitzen draußen unter einer Union-Jack-Girlande. Ich mag England und die Engländer von Tag zu Tag mehr. Und ich merke allmählich, dass der Stress von mir abgefallen ist, selbst das Sodbrennen des verschwunden.
Der letzte Tag ist angebrochen, heute wird es zurückgehen zur Whixall Marina. Die Tour ist ruhig. Auf der Strecke bittet uns der Mitarbeiter eines Elektrizitätswerks – in voller Montur mit Overall und Helm – ein Kabel aus den Bäumen der anderen Uferseite zu fischen. Ich klettere aufs Bootsdach und krabbele auf allen Vieren zur Stelle, an der das Kabel hängt. Mit dem Pflock gelingt es, das Kabel heranzuziehen und auf die andere Uferseite zu befördern. Immerhin eine gute Tat.
Schließlich kommen wir in dem Kanalarm an, der zu unserem Heimathafen führt. Zahlreiche Boote haben dort inzwischen angelegt. Wir müssen noch zwei Zugbrücken bedienen und fahren schließlich die letzten Meter an unsere Anlegestelle. Die nächsten Schritte sind weitestgehend Gehrinschmalz-lose Routine. Wir füllen Wasser nach, hängen uns an den Stromanschluss. Ein älterer Herr mit Hawaiihemd schlendert über den Steg und erklärt, dass wir gerade den Strom klauen, den der Mieter des Platzes zahlen muss, auf dem wir unerlaubterweise stünden. Ups. Er erzählt uns, dass er in Thailand lebe („great place“) und eine Räuberpistole über den Diebstahl seines Boots (das er gemeinsam mit seinem Sohn und ein paar Kumpels eigenhändig zurückgekapert habe).
Der Urlaub klingt aus. Eine letzte Kniffel-Runde, eine letzte selbstgekochte Mahlzeit, eine letzte Nacht. Schließlich werden wir von unserem Taxi in Richtung Manchester Airport abgeholt. Die grünen Wiesen und Hecken weichen, Beton und Zement erobern die Szenerie. Es war schön, wir kommen wieder.